
Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科
 Traditions
Traditions


合唱指一种集体性的歌唱艺术。在合唱中,人员分成若干声部,分别采用不同的旋律,同时唱歌。这类表演团队被称为合唱团或者合唱队。参加的人员则称做合唱团员或者合唱队员,其所演唱的歌曲称作合唱音乐,但也常遇到将合唱当做合唱团或合唱音乐的简称。
合唱团有不同的分类标准。这些标准只有局部意义,而且其界限也不是固定的:
- 组成:
- 歌唱者的人数:如室内合唱(大约15-30人)、大合唱以及小合唱(人数明显较通常合唱少,甚至有的声部仅有一个人唱)等。
- 伴奏:有伴奏合唱和无伴奏合唱(阿卡贝拉)。
- 艺术质量方面的要求:如室内合唱、音乐会合唱、群众合唱
- 功能和组成:如教堂合唱、声乐协会、广播合唱、歌剧合唱、爱乐合唱、学校合唱、轮回演出合唱、表演合唱、警察合唱、工作合唱
- 风格特点:学院派(德文Schola)、复调合唱(德文Madrigalchor)、清唱剧合唱(德文Oratorienchor)、水手合唱(英文shanty chorus)、灵乐合唱(英文gospel chorus)、理发师合唱(英文barbershop)、爵士合唱等等。有时合唱团也以所唱风格之代表性音乐家或类型命名,如巴赫合唱团、小歌剧合唱团等等。
- 合唱成员:儿童合唱、女童合唱、男童合唱、青年合唱、老年合唱、工人合唱等
Unter einem Chor (von altgriechisch χορός chorós „Tanzplatz, Reigen, tanzende Schar“) versteht man in der Musik eine Gemeinschaft von Sängern, in der jede Stimme mehrfach besetzt ist. Außerdem ist Chor die Bezeichnung für ein von diesem Ensemble aufzuführendes Stück.
Der Begriff Chor in der heutigen Bedeutung prägte sich erst im 17. und 18. Jahrhundert. Bis dahin war ein Chor eine Gruppe von Musizierenden im Allgemeinen. Dies kommt heute noch in Begriffen wie Posaunenchor oder Geigenchor zum Ausdruck.[1]
Zudem bezeichnet Chor in der Instrumentalmusik die verschiedenen Stimmlagen gleichartiger Musikinstrumente (etwa als Flötenchor: Blockflöten von der kleinen Sopranino-Blockflöte bis zum Großbass).
Es gibt verschiedene Kriterien zur Charakterisierung von Chören. Diese sind nicht ausschließlich und häufig überlappend. Es gibt keine einheitliche Taxonomie. Grundsätzlich wird nach den vorkommenden Stimmlagen unterschieden:
- gemischter Chor: Mehrere Stimmlagen sind vertreten, also sowohl Frauen- als auch Männerstimmen. Hierzu zählen auch Knabenchöre, in denen Tenor und Bass besetzt sind
- gleichstimmiger Chor, zum Beispiel Frauenchor, Kinderchor (in gleicher Stimmlage wie ein Frauenchor), Männerchor
Darüber hinaus finden weitere Merkmale Anwendung:
- Anzahl der Singenden, zum Beispiel Kammerchor (etwa 15 bis 30 Mitglieder) oder Großchor. Sind die Stimmen nur solistisch oder höchstens zweifach besetzt, sodass sich die Stimmen nicht chorisch mischen, spricht man von einem Vokalensemble
- Anspruch auf künstlerische Qualität, zum Beispiel Konzertchor, Volkschor
- Funktion bzw. Institution, zum Beispiel Kirchenchor (auch Kantorei), Gesangverein, Rundfunkchor, Opernchor, Studiochor, Singakademie, Philharmonischer Chor, Schulchor, Kurrende, Gauchor, Showchor, Polizeichor, Bundeswehr-Chor, Hochschulchor, Akademischer Chor, Werkschor, Landesjugendchor, integrative Kantorei
- Stilrichtung, zum Beispiel Schola, Madrigalchor, Oratorienchor, Shantychor, Popchor, Gospelchor, Barbershop-Chor, Jazzchor
- vertretene Klientel, zum Beispiel Kinderchor, Mädchenchor, Knabenchor, Jugendchor, Seniorenchor, Arbeiterchor, Bergmannschor, Schwulen- oder Lesbenchor, Winzerchor, deutsch-französischer Chor, Gebärdenchor.
Es gibt viele Chöre, die sich den Namen ihres bevorzugten Komponisten aneignen. Zahlreiche Bachchöre, aber auch Monteverdichöre und Heinrich-Schütz-Chöre zeigen dies für die Barockmusik beispielhaft. Auch klassische, romantische und moderne Komponisten können namensgebenden sein, wie etwa beim Mozart-Chor, Mendelssohn-Chor, Reger-Chor oder beim Hugo-Distler-Chor.
Im 21. Jahrhundert kam es zum Phänomen des virtuellen Chores durch die Darbietung eines Musikstückes durch eine Gruppe von Personen über das Internet. Die Besonderheit ist dabei, dass sich die einzelnen Sänger und der Dirigent nicht im selben Raum befinden. Die Anwesenheit ist ausschließlich über das Internet vermittelt.
Die Christmette ist vom Ursprung her das in der Heiligen Nacht gesungene Stundengebet (Matutin und Laudes) der Kirche zum Weihnachtsfest. Heute ist damit meist die heilige Messe gemeint, die zu Weihnachten in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember gefeiert wird. Der Begriff wird ebenfalls in evangelischen Gemeinden für die gottesdienstliche Feier der Christnacht gebraucht.[1]
Die Christmette gehört mit der Feier der Osternacht zu den beiden großen nächtlichen Feiern im Kirchenjahr. Sie beginnt traditionell um Mitternacht, in vielen Pfarrgemeinden allerdings auch schon um 22 oder 23 Uhr. Aus seelsorgerischen Gründen sind aber auch Zeiten bis hin zu 15 Uhr (frühestmöglicher Beginn) erlaubt, z. B. für spezielle „Senioren-“ oder auch „Kindermetten“ als Wort-Gottes-Feiern ohne Eucharistiefeier, häufig auch „Krippenfeier“ genannt. Bis zum 17. und 18. Jahrhundert fand die Mette meist am frühen Weihnachtsmorgen statt. Dieser Brauch ist heute noch in wenigen evangelischen Gemeinden, besonders aber im Erzgebirge[2] anzutreffen. Die Mette wird in diesem Zusammenhang „Uchte“ genannt. Mancherorts singt der Kantor, der Hebdomadar oder der Priester unmittelbar vor der Christmette die feierliche Ankündigung der Geburt des Herrn nach dem Römischen Martyrologium, die ursprünglich zur Prim gehörte – ein weiteres Anzeichen für den Charakter der Christmette als Nachtgottesdienst mit Messfeier und Elementen aus dem Stundengebet.
In vielen Familien gehört der Besuch eines Gottesdienstes am Heiligen Abend zum gewohnten Ritual, auch unabhängig von einer regelmäßigen Gemeindebindung. Die Gottesdienste am Heiligen Abend sind daher in allen christlichen Konfessionen die am besten besuchten im ganzen Jahr. In vielen Gemeinden finden am Spätnachmittag oder frühen Heiligabend weihnachtliche Gottesdienste, Krippenspiele oder „Kinderchristmetten“ statt. Diese sind keine Christmetten, sondern Christvespern oder – falls es sich um Eucharistiefeiern handelt – Abendmessen.
In manchen Gemeinden ist es Brauch, beim Einzug die Figur des Jesuskindes – volkstümlich „Christkind“ genannt – in die Weihnachtskrippe zu legen. Die Christmette ist die erste der drei Messen des Weihnachtsfestes, auf sie folgt die Hirtenmesse und die Messe vom Tag.













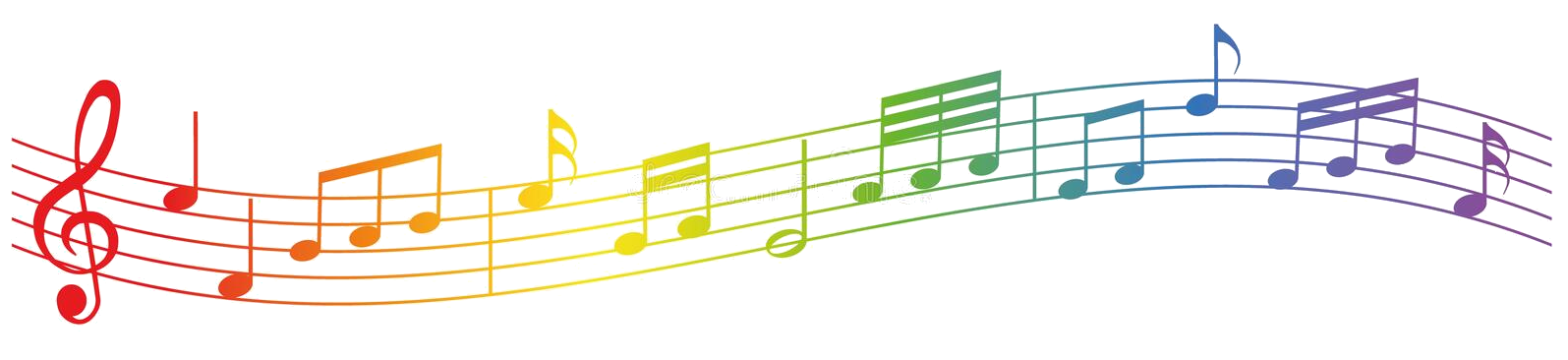 Music
Music



 Christmas Market
Christmas Market
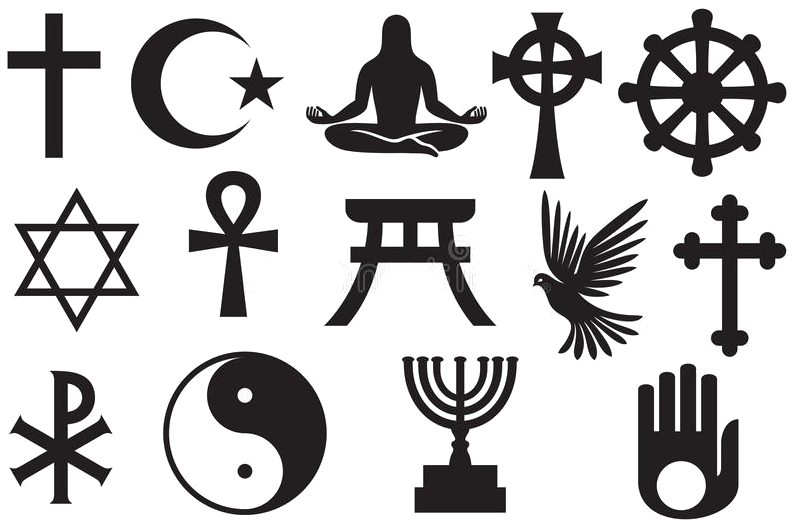 Religion
Religion
 Traditional medicine
Traditional medicine
 Botany
Botany
 Art
Art
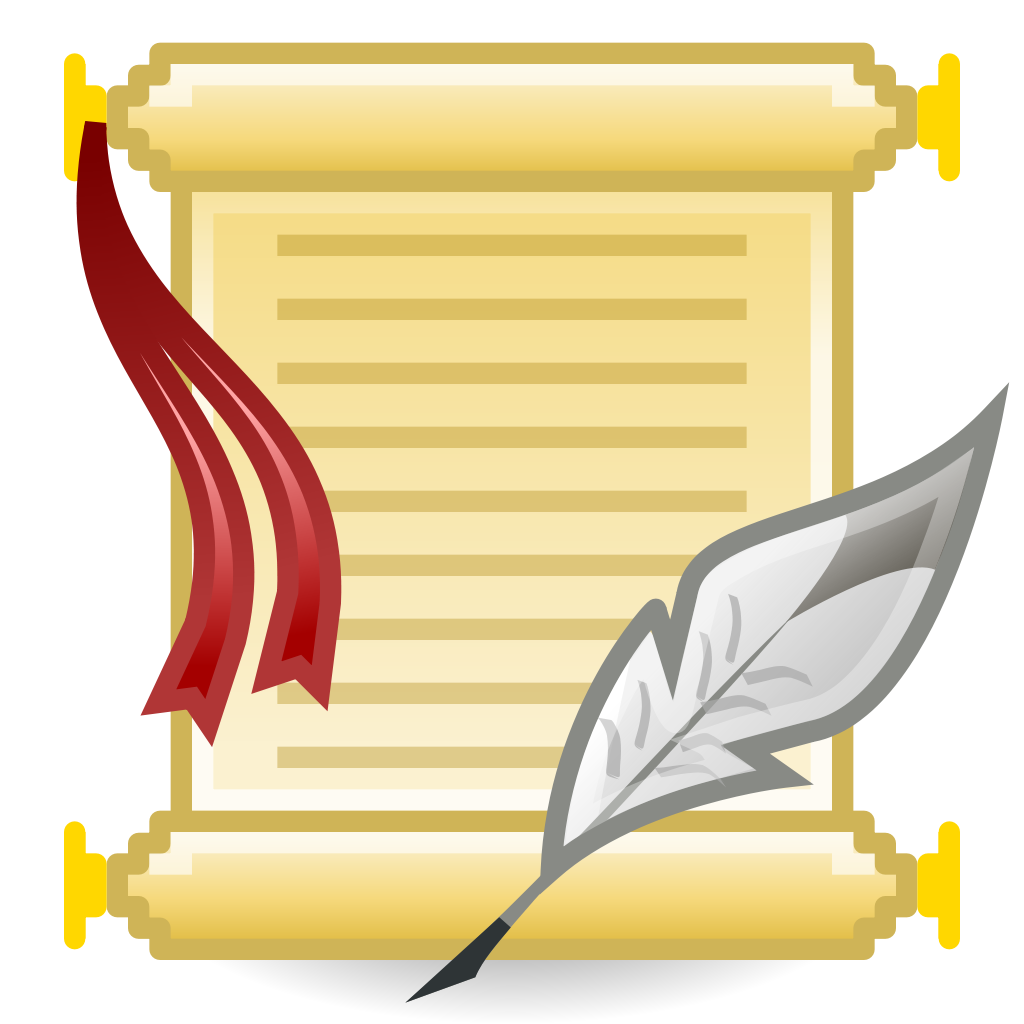 History
History
 Review
Review
 Fashion world
Fashion world
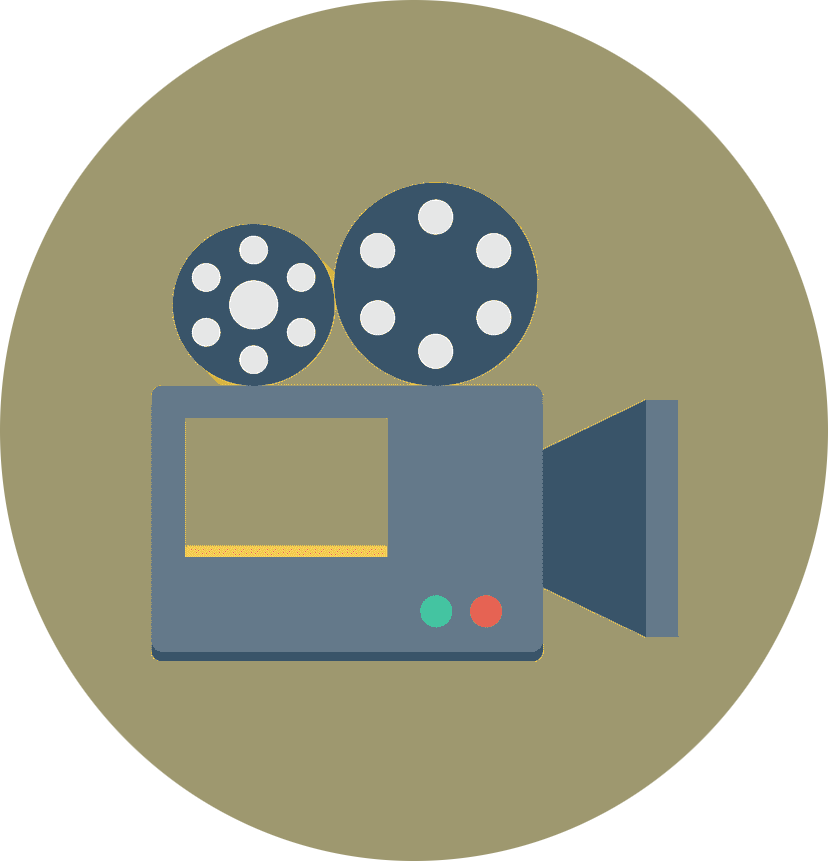 Film & TV Produktion
Film & TV Produktion
 Architecture
Architecture
 Civilization
Civilization